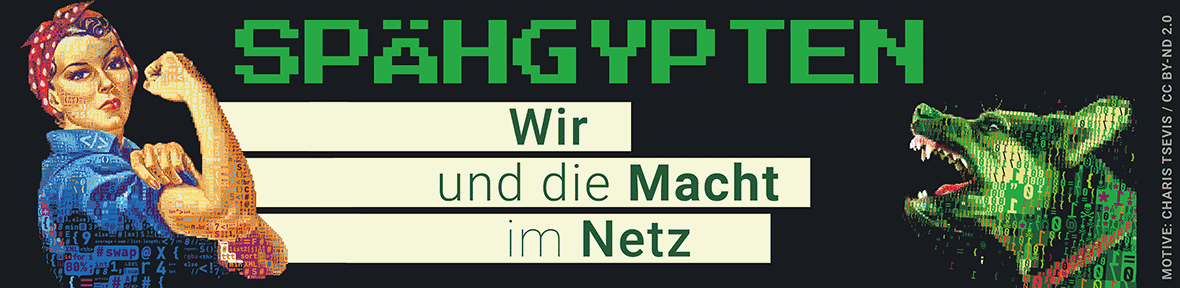Keine Cookies, klare Sicht – einfacher wird Read-it-later nicht!
Omnivore ist die datensensibelste Später-lesen-Anwendung – und ein Umzug vom Platzhirschen Pocket ist – dank ChatGPT – easy! Das Lesen von Webartikeln über eine Read-it-later-App ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung. Eine Read-it-later-App ist eine Anwendung, die es erlaubt, Onlineartikel oder Webseiteninhalte zu speichern, um sie später offline und in einem einheitlichen, individuell anpassbaren Format zu speichern. Schriftgröße, Schriftart und Hintergrundfarbe können definiert werden und alle Webartikel, deren URL in der…