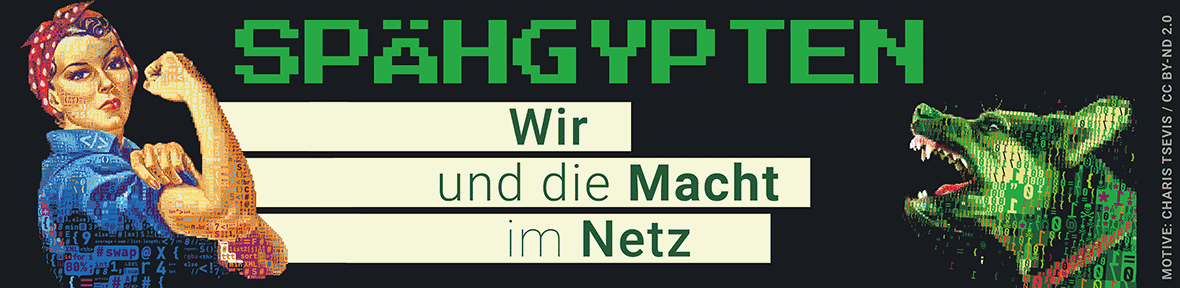Private Daten als KI-Futter – bitte sehr, Mark Zuckerberg!

Es liegt in der Architektur von KI-Modellen begründet, dass die Herkunft der Daten, sind sie einmal im KI-Modell, ist nicht mehr nachvollziehbar. Niemand weiß, in welchen Antworten von Meta-AI welcher Kommentar verwurstelt ist, in welchen KI-generierten Bildern und -Videos die Selfies mit den BFFs oder die Gesichter aus dem Cliquenfoto remixed wurden.